Vor nicht allzu langer Zeit war die Literaturrecherche eine durch Knappheit, Einschränkungen und einen gewaltigen Hindernisparcour gekennzeichnete Frustrationsroutine. Spezialbibliotheken mussten aufgesucht, entfernte Archive besucht, Zettelkataloge durchwühlt, Fernleihformulare erledigt und schier endlose Wartezeiten ertragen werden.
Heuer, im Zeitalter des sofortigen, unbegrenzten Zugriffs auf digitale Kataloge und damit schier unerschöpflich-universalbibliographische Archive, hat sich diese Erfahrung grundlegend verändert.
Recherche ist inzwischen bedrückend vorhersehbar: Jeden Morgen öffnen wir über Datenbanken mehr Artikel, Aufsätze etc., als wir jemals Zeit zum Lesen haben, jeden Mittag wird die Materialfülle geordnet, in einem Umfang, der aufgrund unsere beschränkten geistigen Fähigkeiten schon am Folgetag wie Unordnung wirkt, und am Abend folgt dann das verzweifelte Eingeständnis der eigene Sterblichkeit und der Unbeschränktheit all der Dinge, zu denen wir nicht kommen. Vielleicht spiegelt Wissenschaft damit endgültig die Welt – chaotisch, ein Echtzeit-Wahnsinn. Elfenbeinturm no more!
Das “Allessein” des Internets ist in der Wissenschaft angekommen. Das Internet ist die Utopie einer Bibliothek, die alle denkbaren wissenschaftlichen Inhalte enthält. Eine real existierende Universalbibliothek, eine totale Bibliothek echtzeitiger Umfassendheit.
Das Gefühl des Mangels ist einer seltsamen Art Müdigkeit gewichen – jedenfalls ist der Zugriff auf die Universalbibliothek unserer Zeit weniger befriedigend als gedacht. Denn egal wieviel Material man sichtet, schon hinter dem nächsten Klick, dem nächsten Scroll, lädt ein nicht enden wollender Horizont der Aufklärung. Es gibt immer noch mehr, noch nicht erlangte Erkenntnismöglichkeiten. Wissenschaft, so scheint es, ist ein infinites Stream neuer wissenschaftlicher Produktion, eine rückwärts chronologisch sortierte Unendlichkeit.
Niemals zuvor war es einfacher, Wissenschaft als unvollendet, mehr noch, permanent unvollendet zu denken. Die Frage, warum man denn diese etgy-neuste Studie zum Thema nicht hat einfließen lassen, ist fast schon obligatorisch. “Jetzigkeit” ersetzt immer mehr die intime Vertrautheit mit einem bestimmten Werk.
Diesen Erfahrungen folgt Erschöpfung, vielleicht sogar eine Art von Traurigkeit, eine melancholische Grundstimmung, die sich in der Frage definiert, ob denn jemals ein einzelner Mensch da mithalten kann. Symptome dieser Art “Neurasthenie” sind das anhaltende Gefühl einer prinzipiellen Lückenhaftigkeit und Unabgeschlossenheit der Recherche trotz ausreichender Suchphase, eine Überforderung wegen Materialfülle bereits nach minimalster Recherche während der Sichtungsphase sowie eine verzögerte Schreibaufnahme für das eigene Werk. Es scheint als sei uns das “Ende” abhanden gekommen…
Der unerfüllbare Wunsch wird stark, mehrere Artikel gleichzeitig lesen zu können – ein Begehren, das zumindest das Genre der Metanalyse oder Literaturübersicht teilweise befriedigt und somit die akademische Literaturgattung des 21. Jahrhunderts zu werden scheint, weil es der “Ökonomie der Aufmerksamkeit” Rechnung trägt.
Was bleibt? Ein kollektives Fatigue-Syndrom. Das Gefühl, gelähmt und überwältigt zu sein, von allem, was man nicht weiß. Der Polyhistor ist endgültig gestorben – Diagnose gebrochenes Herz.
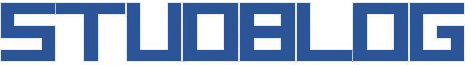
3 Kommentare
Gino schreibt:
Dez 23, 2014
Toller Artikel! Das erinnert mich auch an Tinder und Spotify…
KOM schreibt:
Dez 24, 2014
kenn ich
Heike Baller schreibt:
Dez 29, 2014
Meine Frage lautet immer wieder: Hab ich alle Möglichkeiten gecheckt? Das Gefühl der Überfülle kenn ich da auch, versuche aber, mit Dokumentation der abgearbeiteten Schritte dagegen zu halten. Und manchmal ist es wichtiger, einen Ursprungstext tatsächlich zu kennen als die drölfigste Beschäftigung damit.
In der Tat: Ein Problem unserer Zeit – und sehr schön dargestellt. Danke!