Der Schock sitzt bei vielen tief, sobald sich ein charmanter, scheinbar selbstbewusster und ebenso erfolgreicher Student das Leben nimmt. Und das immer öfter: Statistiken zeigen, dass die Verordnung von Antidepressiva an Hochschulbesucher seit 2006 um circa 43 Prozent stieg (hier).
Warum versinken so viele Studierende in Depressionen, um dann in oben genannter Statistik aufzutauchen? Abgesehen von genetischen und neurobiologischen Faktoren, gibt es studiumsinduzierte Ursachen? Ein Versuch:
Ausgebildet dazu, stets alles zu tun, um perfekt zu sein, aber ohne wirklich zu wissen, warum (bloß keine Supermarktkasse!), fühlen sich viele Studierende und Jungakademiker als Versuchstier eines grausamen Experiments. Ein kafkaesker Labyrinth-Test, bei dem jede Abweichung vom kürzesten Weg zum Ziel (Bestnoten) vom unnahbaren Experimentator als “Fehler” registriert werden – entsprechend oft rennt man gegen die Wand einer ausweglosen erscheinenden Sackgasse.
Die meisten Studierenden waren schon im Kindesalter stets die Besten ihrer Klasse, Eltern und Lehrer gleichermaßen stolz. Daraus entwickelt sich oft ein falsches Selbstwertgefühl: Denn was viele Kinder wirklich lernen ist, dass Liebe und Anerkennung von ihrer Leistung abhängt. Wenn sie dann einmal scheitern, resultiert daraus ein gewaltiger Ego-Kollaps, eine existenzielle Machtlosigkeit, nach der sie sich buchstäblich wertlos fühlen.
Auf dem Campus hat man inzwischen “mühelos perfekt” zu sein, d.h., smart, fit, schön, beliebt – und das alles ohne sichtbare Anstrengung. An US-amerikanischen Elite-Unis nennt man dieses Phänomen “Enten-Syndrom”: Eine Ente scheint ruhig über das Wasser zu gleiten, unter der Oberfläche aber muss sie hektisch und unerbittlich paddeln.
Es ist schlimm genug, am Ende eines Tages erschöpft, gestresst und deprimiert ins Studierzimmer zu kommen; noch schlechter ist es, wenn es auf Facebook und Co. dann so scheint, als würden alle anderen Kommilitonen ein perfektes Leben haben. Social Media erhöhen die Anzahl der sozialen Vergleiche und verstärkt damit das Gefühl von Einsamkeit und Hilflosigkeit.
An Universitäten ist es immer noch zu schwierig, sich Zeit für eine Therapie zu nehmen. Auch Nachteilsausgleiche, selbst bei Wahrung der fachlichen Anforderungen in vollem Umfang, sind nicht immer gewährleistet; ansonsten kompliziert und damit zusätzlich belastend. Oft genug werden Betroffene zunächst belächelt. Man hat ja keine – nach außen sichtbare – Wunden.
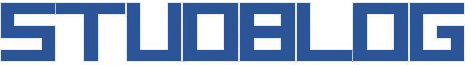
1 Kommentar
KOM schreibt:
Sep 15, 2015
sehr traurig…